|







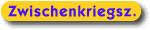

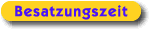











|




|












|
|
Die Stukkaturen
in der Kirche St. Johann Nepomuk
Alle Wände der Kirche sind bis zum Gesimskranz, also bis
zu einer Höhe von 8 m, mit Stuckmarmor verkleidet. Dabei sind alle tragenden
Gebäudeteile wie Pfeiler, Zwischengebälk, Bogen über dem Hochaltar,
der Aufbau über dem Hochaltar, alle Nischen- und Fensterrahmen, der
Gesimskranz usw. in einem von hellgrauen Adern durchzogenen zarten Rosa
gehalten. Die Flächen zwischen diesen tragenden Gebäudeteilen bedeckt
ein hellgrauer, geäderter Stuckmarmor. Die beiden Säulen links und rechts
des Hochaltares sind dunkelgrüner Stuckmarmor, die Umrahmung der Bilder
über den Seitenältären sowie die Altarnische sind imitierter Marmor,
und zwar hellgrüner Stuck. Das Hochaltarbild ist in einen schwarzen
Rahmen eingespannt.

|
Stuckarbeit über dem
Altarbild
|
|
Die Farben sind alle so dezent, daß man die Buntheit gar
nicht gewahr wird, aber auch deshalb, weil diese Buntheit von der reichen
Stuckdekoration in Gold unterdrückt wird. Die wichtigsten Stukkaturen
in Gold sind die Kapitäle der Pfeiler und Säulen, alle Flächen, die
eine Füllung erfordern, der Schmuck um Bilder-, Nischen- und Fensterrahmen,
Dekorationsteile über dem Hochaltar, besonders Rahmen um das Flachrelief
Johannes des Täufers, und das Monogramm an der Decke über dem Kircheneingang
mit den Buchstaben G.W.K. und A.C.K. (die Bauherrn Gregor Wilhelm Kirchner
und Anna Christina Kirchner).
Für den nicht bekannten Meister der prächtigen Stuckarbeiten,
wozu auch die Herstellung des Kunstmarmors (stucco lustro) gehört, hat
Franz Österreicher eine interessante Eintragung in den Laaber Taufmatriken
gefunden die auf den Stukkateurmeister Johann Michael Bolla hinweist.
Die Stuckarbeiten
im Kaiserzimmer
Die Stuckarbeiten im Kaiserzimmer sind laut aufgefundener
gemalter Inschrift mit 1724 datiert. Anton Camasina, Stukkateur, scheint
als Trauzeuge bei einer Hochzeit in den Laaber Pfarrmatriken am 12.
November 1724 auf, er wird als im Buchhalterhof wohnhaft bezeichnet.
Franz Österreicher schreibt über diese Arbeiten:
"Es ist naheliegend, daß der Aufenthalt des Stukkateurs
Camasina mit Stuckarbeiten im Schloß zusammenhing, denn seine Arbeiten
konnten nicht in einer heimischen Werkstatt andernorts vorgenommen und
nach Breitenfurt transportiert worden sein, wie das zum Beispiel bei
Ölgemälden oder Bildhauerarbeiten möglich war. Die Stuckarbeiten mußten
im Buchhalterhof selbst an Wänden und Decken verfertigt werden. Dazu
kommt noch etwas Besonderes: Im Kaiserzimmer ist die Jahreszahl 1724
in einer Eckabschrägung über den Kamin gemalt und nimmt so auf die Dekoration
dieses Raumes Bezug. Dieses Jahr 1724 ist also dasselbe, in dem Anton
Camasina - wie oben berichtet - als Trauzeuge fungierte. Es ist daher
durchaus naheliegend, die Stukkaturen im Kaiserzimmer Anton Camasiner
zuzuschreiben.
Dazu muß noch gesagt werden, daß diese Jahreszahl 1724 erst
im August 1954 entdeckt wurde. Als man bei Malerarbeiten die alten Farbanstriche
abschabte, kam diese Jahreszahl wieder zum Vorschein. Leider hat Pfarrer
Hartmann - wahrscheinlich in Unkenntnis der Bedeutung - diesen Vorfall
in der Pfarrchronik nicht vermerkt. Aber er hat mir diese Jahreszahl
gezeigt, und ich habe sie selbst gesehen und auch notiert. Sie wurde
damals vom Malermeister Weckerl aus Wien-Rennweg deutlich sichtbar gemacht,
d. h. mit Farbe nachgezogen. Auch Malermeister Wyhlidal in Breitenfurt
hat sie gelegentlich seiner Arbeiten im Kaiserzimmer 1970 originalgetreu
erneuert. Der Zusammenhang zwischen dieser Jahreszahl und Anton Camasina
ist mir selbst erst 1971 bei Zusammenstellung der wenigen aus der Baugeschichte
des Schlosses bekannten Daten aufgefallen."
Das Kaiserzimmer ist nur 3 m breit, aber 5,7 m lang und
4,4 m hoch. Es besitzt nur ein Fenster, dessen Nische 3,2 m hoch und
0,4 m tief ist. Ihre Seitenflächen sind mit Stuckarbeiten verziert,
deren Vergoldung jedoch schon Schaden genommen hat. Die vier Zimmerwände
sind bis zu einer Höhe von 3,60 m glatt, ohne jeden Schmuck, eine gewöhnliche
Malerarbeit, die mehrfach erneuert wurde. In der Höhe von 3,6 m jedoch
beginnt ein Stuckgesims, daß alle vier Wände entlang läuft und aus zwei
verschiedenen Bandornamenten besteht, deren Vergoldung wieder zum Teil
beschädigt ist. In allen vier Ecken dieses Gesimses sind Stuckverzierungen
angebracht. Die Südwestecke des Zimmers ist wegen des Kamins abgeschrägt.
Dort ist die oben erwähnte Jahreszahl 1724 in schwarzer Farbe angebracht.
Nach dem Übergang dieser senkrechten Zimmerwände in die waagrechte Zimmerdecke
finden sich reiche Stuckarbeiten vor allem in den Mitten der beiden
Längs- und Breitseiten, besonders aber in den vier Ecken des Plafonds.
Das Flachrelief am Plafond hat in seiner größten Ausdehnung
4 m in der Länge und 2 m in der Breite. Es ist gänzlich aus weißem Stuckmaterial
hergestellt. Im Mittelpunkt dieses Flachreliefs thront, von vielen Wolken
umgeben, die Zeustochter Pallas Athene (Minerva). Sie ist mit wallenden
Kleidern angetan, trägt am Kopf einen mit Federn geschmückten Helm und
hält in der rechten Hand eine Lanze. Ihr linker Unterarm stützt sich
auf einen Schild, der das schlangenumwundene Haupt der Medusa (Gorgo)
zeigt, nach der griechischen Sage ein weibliches Ungeheuer, bei deren
Anblick der Betrachter versteinert wurde. Lanze und Schild können wohl
als Symbole des Krieges gedeutet werden. Pallas Athene war aber nicht
nur die Schutzgöttin der Kriegshelden, sondern auch der Wissenschaft
und Künste. Die beiden Letzteren werden durch Globus und Buch, Zirkel,
Winkelstein und Meßstab symbolisiert. Palles Athene wird von drei kleinen
Engeln umgeben, wovon einer keine besondere Bedeutung zu haben scheint,
aber ein von rechts und ein von links herbeischwebendes Engelchen bringt
je einen Lorbeerkranz der Göttin entgegen. Es liegt nahe, sie als Siegeskränze
für erfolgreiche Schlachten gegen die Türken durch Prinz Eugen bzw.
die wissenschaftlichen und künstlerischen Erfolge der Barockzeit zu
deuten.
Die Entscheidung über die Frage, ob Anton Camasina neben
der ornamentalen Dekoration des Kaiserzinmers auch die Herstellung dieses
Flachreliefs zugeschrieben werden darf, müssen Experten noch entscheiden.
|

