|







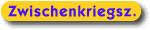

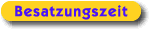











|




|












|
|
Der Steinmetz
Johann Fidler (1728)
Rund vier Jahre vor der Einweihung der damaligen Breitenfurter
Schloßkapelle arbeitete der Steinmetz (lapicida) Johann Fidler
im Breitenfurter Buchhalterhof. Laut Laaber Trauungsbuch heiratete er
am 10. August 1728 in der Laaber Pfarrkirche Anna Theresia lichtenscheid.
Der Bräutigam Johann Fiedler war der Sohn des bürgerlichen
Maurermeisters Laurenz Fidler in Hainburg und seiner Frau Anna Maria,
lebte aber 1728 im Buchhalterhof als Steinmetz. Die Braut Anna Theresia
Lichtenscheid stammte aus Wieselburg und wohnte nun bei Johann Michael
Madler, der als Chirurgus /Wundarzt, Bader) in Breitenfurt bezeichnet
wird, und auch ihr Beistad war.
Der Steinmetz
Franz Engelmann (1734)
Am 16. September 1734 - die Schloßkapelle war bereits
konsekriert - wird in der Laaber Pfarrkirche der Bub Thomas kölbl
getauft. Die Mutter war Maria Kölbl, eine ledige Breitenfurterin
aus der weitverzweigten Familie Kölbl. Der Vater war der enbenfalls
ledige Franz Engelmann, von dem nur aufgeschrieben steht, daß
er Steinmetzgeselle gewesen ist, und in Breitenfurt wohnt (mindestens
seit Dezember 1733).
Die Steinmetzarbeiten
in der Kirche St. Johann Nepomuk
Von keinem der beiden genannten Steinmetzen ist bekannt,
welche Arbeiten ihre Meißel geschaffen haben, doch liegen beide
uns bekannte Jahreszahlen nahe dem September 1732, der Zeit der Konsekration
der Schloßkapelle.
Es kann daher angenommen werden, daß sie an der Vollendung
der Schloßkapelle gearbeitet haben. Steinmetzarbeiten in dieser
sind die prächtige Kommunionbank aus Marmor, die Marmorbrüstung
auf der Orgelempore, die Balkonbrüstung vor dem Orgelchor über
dem Kircheneingang, das schöne marmorne Waschbecken in der Sakristei,
Vasen und Zierate an der Außenseite der Kirche und des Kaisersaales.
Es könnte ja auch sein, daß die beiden Steinmetzen an der
Ausstattung des Schlosses selbst gearbeitet haben. darüber läßt
sich aber überhaupt nichts aussagen, da uns vom Schloß viel
zuwenig bekannt ist.
Bemerkt sei noch, daß in die Gartenmauer des Klosters
Augustineum einige Reste von Steinmetzarbeiten eingemauert wurden, die
sehr wahrscheinlich aus dem 1801 zerstörten Kaisersaal stammen
dürften.
|

