|







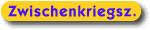

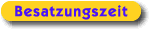





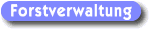





|
|
Die Anfänge
und die Bannwaldzeit
Der von den Babenbergern im 11. Jahrhundert erstmals in
Besitz genommene Wienerwald dürfte damals ein kaum unterbrochener Urwald
gewesen sein. Die Gründung der Orte Mauer, Rodaun, Kalksbugrg, Liesing
und Perchtoldsdorf legte den Grundstein für die Bewirtschaftung dieses
Waldes.
Eine 1457 von Kaiser Friedrich III. erlassene Verwaltungsbestimmung
deutet auf eine geordnete Bewirtschaftung hin. Damals bestand bereits
das Forstamt des Wienerwaldes, dem zwölf Ämter (officia) mit Waldförstern
unterstanden. Eines davon hatte ihren sitz in Laab.
Die Landesfürsten nutzten den Wald vorwiegend für die Jagd
und entzogen ihn bis in das 16. Jahrhundert der Besiedlung und weitgehend
auch der forstwirtschaftlichen Nutzung. Diese Zeit wurde darum die Bannwaldzeit
genannt.
Die Entstehung
der Forstverwaltung
Wegen Grenzsteitigkeiten und sonstiger Mißstände ordnete
Kaiser Ferdinand I. in Jahre 1522 eine Bereitung und Grenzbegehung des
Waldamtgebietes an, damit der Wald neu beschrieben und eine neue Instruktion
Waldungs-, Urbar- und Grundbücher anfertigen konnte.
Die Gründung der Ortschaften im Liesingtal geht auf die
Ansiedlung von Waldarbeitern zurück. Besondere Erwähnung verdienen in
diesem Zusammenhang zwei Einrichtungen im Wienerwald, nämlich die "Duckhütte
und Viertelpfenniggebühr". Das Waldamt hat, um den Ackerbau nicht zu
schädigen und den bestehenden Siedlungen keine Arbeitskräfte zu entziehen,
aus der Steiermark, Salzburg und Bayern Holzhauer zur zunehmenden Holzversorgung
Wiens herbeigeholt, und es wurden ihnen Örtlichkeiten im Wienerwald
zugewiesen, wo sie ihre Unterstandshütten errichten konnten. Da in vielen
Gebieten, aus denen diese Holzarbeiter stammten, die verehrung des heiligen
Blasius zu dieser Zeit sehr verbreitet war, erkoren sie ihn zu ihrem
Schutzheiligen und feiern ihm zu Ehren bis heute alljährlich ihren
Holzhackerfeiertag. das Das für den Bau
dieser Duckhütten nötige Material und Geld wurde ihnen vom Waldamt in
Purkersdorf, zu dem sie in einem Abhängigkeitsverhältnis standen, ausgefolgt.
Den Breitenfurter Waldamtsuntertanen oblag es unter anderem die Verpflichtung,
daß für die Hofburg bestimmte Brennholz in den kaiserlichen Holzhof
nach Wien zu bringen. Als später kein Mangel an Arbeitskräften bestand,
wurden ihnen die Hütten weiter überlassen und Holzbezugs- und Weiderechte
eingeräumt. Dagegen waren sie verpflichtet, gewisse Abgaben und bei
Bedarf Holzarbeiten zu leisten.
Die Viertelpfenniggebür dürfte ursprünglich aus privatrechtlichen
Vereinbarungen im Zusammenhang mit Grundabtrennungen und Schenkungen
entstanden sein, erhielt aber spätestens 1722 einen öffentlichen Charakter,
als sie nämlich zum landesfürstlichen Regal erklärt wurde. Dieses Regal
bestand darin, daß jeder Waldbesitzer im Wienerwald bei einem Holzverkauf
aus seinem Wald verpflichtet war, einen vierten Teil des Erlöses an
die Staatsforstverwaltung abzuführen. Später wurde an die Ablösung dieser
Rechte im Wege der freien Vereinbarung geschritten, bis schließlich
im Jahre 1874 die Aufhebung dieser Last im Gnadenweg erfolgte.
Nachdem 1678 abermals eine Grenzbegehung erfolgt war, wurde
von Kaiser Karl VI. eine neue ausführliche Instruktion für den Wienerwald
erlassen.
Im Jahr 1755 übergab Kaiserin Maria Theresia den gesamten
Wienerwald in das Staatseigentum.
1782 ordnete Kaiser Josef II. die Vereinigung des bisher
immer getrennten Jagddienstes mit dem Walddienst an, richtete das "niederösterr.
Waldamt" (Oberforstamt) in Purkersdorf ein und unterstellte es dem Obersthof-
und Landjägermeister, aber nicht ohne Bestimmung für die besondere Behandlung
von Forstfragen (z.B. Schlägerungen durch die Hofkammer) zu treffen.
Nach Gründung dieses Oberforstamtes in Purkersdorf dürfte
auch die Neuorganisation der territorialen Einheiten des Wienerwaldes
das Forstamt für das hiesige Gebiet nach Breitenfurt gebracht haben.
In diese Zeit fällt die Errichtung des bis 1979 noch in Betrieb stehende
Forstverwaltungsgebäudes am Stelzerberg.

Die alte Forstverwaltung am Stelzerberg |
Nachdem im Laufe der Zeit die Agenden immer mehr im Oberjägermeisteramt
in Wien behandelt wurden, wurde schließlich 1828 das Oberforstamt in
Purkersdorf aufgelassen. Unter Leitung des Obersthof- und Landjägermeisteramtes
(zugleich niederösterr. Waldamt) wurde der Forstbetrieb im Wienerwald
von fünf "Waldbereitungen", die wiederum in 30 Forstwirtschaftsbezirke
zerfielen, aufgeteilt. Die Waldbearbeitung Breitenfurt zerfiel in die
Forstwirtschaftsbezirke Wögler Forst, Breitenfurter Forst, Kaltenleutgebner
Forst und Anninger Forst. Die vier Forstwirtschaftsbezirke wurden in
einer Beaufsichtigung in 12 Schutzbezirke unterteilt. Das Territorium
Breitenfurt war um Teile des heutigen Försterbezirkes Wolfsgraben größer,
deckte sich jedoch ansonsten mit der jetzigen Bezirksgröße.
Eine Änderung der Oberorganisation ergibt sich 1849, als
vom neugeschaffenen Ministerium für Landkultur und Bergwesen eine Forstdirektion
in Wien errichtet wurde, die für alle vom Staat verwalteten Forste in
Österreich unter der Enns zuständig sein sollte. Aber auch diese Organisation
war nur von kurzer Dauer, weil die staats- und Fondsgüterverwaltung
1853 zum Finanzministerium kam, das dann auch die Forstdirektion für
Niederösterreich auflöste. Die territorialen Forstämter blieben nahezu
unverändert. Die 5 Wienerwald Inspektions-Forstämter wurden, soweit
größere Einheiten vorlagen (Alland, Breitenfurt, Purkersdorf), von einem
"Forstmeister" und in Neuwaldegg und Ofenbach von einem Oberförster
geleitet. Den Forstämtern unterstanden wiederum die Revierverwaltungen
(Breitenfurt 4) und Schutzbezirke (Breitenfurt 12). Diese Regelung wurde
erst 1873 von der grundlegenden Neuorganisation abgelöst.
Die Reform 1873
Die Staats-, Religions- und Studienfondsgüter wurden 1872
dem 1867 neu gegründeten Ministerium für Ackerbau zugewiesen. Desgleichen
wurden die bis dahin beim Ministerium für Kultur-Unterricht gelegene
oberste Verwaltung der Güter des Bukowianer griechisch-orientalischen
Religionsfonds diesem Ministerium angegliedert. Durch die mit der allerhöchsten
Entschließung vom 23. März 1873 genehmigten Grundzüge für die Verwaltung
der Staats- und Fondsforste und Domänen, die mit Verordnung des Ackerbauministeriums
in Kraft gesetzt wurden, kam es zu einer Neuorganisation, die ihren
Grundzügen nach bis 1925, also 52 Jahre, in Geltung stand.
Demnach oblag die Leitung der dem Staat und den öffentlichen
Fonds gehörigen Forste und Domänen:
I. dem Acherbauministerium
II. den Forst- und Domänendirektionen (für Niederösterreich und
Wien)
III. den Forst- und Domänendirektionen (Wirtschaftsführern)
Den Unterschied zu den 1849 geschaffenen Regelungen lag
darin, daß die Forstämter als 2. Mittelinstanz weggefallen sind. Der
Schwerpunkt lag nun bei den Forst- und Domänenverwaltungen, die zu einem
vom Forstverwalter (Oberförster oder Förster) geleiteten, umfassenden
Wirtschafts- und Verwaltungsbezirk geworden waren und wieder aus einigen
Forstschutzbezirken bzw. -revieren bestanden. Zur Unterscheidung von
früheren Forstämtersystem wurde diese Organisationsform "Oberförstersystem"
genannt.
Im Bereich der derzeitigen Forstverwaltung Breitenfurt bestanden
3 solche k. u. k. Forst- und Domänenverwaltungen, und zwar in Breitenfurt,
Wöglerin und Hinterbrühl, wobei Breitenfurt sich in 4, Wöglerin in 3
und Hinterbrühl in 5 Schutzbezirke unterteilte.
Je nach Transport des Holzes zu Wasser durch trift oder
zu Land wurden die Forstverwaltungen in Achsforsten und Schwemmforste
unterteilt.
"Beim Transport wird nach Vollendung der Schlägerung das
gesamte Holz an die bestehenden Waldwege abgerückt und auf diesen in
keinen Ladungen den Waldstraßen und öffentlichen Kommunikationswegen
zugeführt. Hier erfolgt das Umladen auf Fuhrwerke und der Weitertransport
nach den endlichen Bestimmungsorten, zumeist der Reichshauptstadt Wien.
Das Waldwegenetz, obwohl im steten Wachsen begriffen, hat jene Ausgestaltung
noch nicht erreicht, welche mit Rücksicht auf die Größe und Bedeutung
des Wienerwaldes wünschenswert erscheint. Die erste Anregung von Bedeutung
zum Ausbaue derselben gab 1851 ein Erlaß der niederösterr. Forstdirektion,
welche die Verbesserung der Kommunikationsanstalten ins Auge faßte und
den Entwurf von Plänen für den Ausbau derselben mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse des ganzen Komplexes anordnete. Von nun an hat man in dieser
Richtung mit wechselnder Intensität weitergearbeitet. In der letzten
Zeit wurde besonders die Vermehrung der öffentlichen Straßen angestrebt
und sowohl durch einen kostspieligen Umbau bestehender Waldstraßen zu
Bezirksstraßen und die Anlage neuer Straßenzüge als auch durch ausgiebige
Subventionen der Neuanlage von Gemeindewegen und Bezirksstraßen wirksam
gefördert."
In diesem Zusammenhang wurden folgende Forststraßen im Bereich
Breitenfurt in die öffentliche Verwaltung übergeben:
Kaltenleutgeben-Sulz-Stangaustraße (7 km)
Höniggraben-Buchelbachstraße (3,5 km)
Preßbaum-Laab und Preßbaum-Breitenfurterstraße (13,5 km)
Gruberau-Geschriebene Buchenstraße (5,8 km)
Umlegung der Hochroterdstraße (1 km)
Die Organisationsreform nach 1873 wurde prinzipiell bis
1925 beibehalten.
Eine kleine Änderung im hiesigen Bereich war, daß 1891 die
k. u. k. Forst- und Domänenverwaltung Wöglerin aufgelöst und der Domänenverwaltung
Breitenfurt angeschlossen wurde.
Die Zeit nach
dem 1. Weltkrieg und das Bundesforstgesetz 1925
In den ersten Jahren nach dem 1. Weltkrieg, in denen die
Sicherung der Ernährung und Linderung der Brennstoffnot im Vordergrund
standen, wurde an den Wald große Anforderungen gestellt. Holz war in
Österreich der wichtigste Ausfuhrartikel und damit Tauschobjekt für
Lebensmittel.
Die geänderten wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse
sowie Sparmaßnahmen während dieser Zeit waren notwendig und für die
Reform 1925 mitentscheidend. Im Bundesforstgesetz des Jahres 1925 wurde
bestimmt, daß die Leitung der Österreichischen Bundesforste der Generaldirektion
obliegt, die dem Bundesminister unterstellt ist und den Betrieb vertritt.
Mit diesem Gesetz wurde nach einer Übergangszeit die bisherigen
Forst- und Domänendirektionen aufgehoben und die k. u. k. Forst- und
Domänenverwaltunen in die Forstverwaltungen der Österreichischen Staatsforste
überführt.
Eine solche löste die Forst- und Domänenverwaltung Breitenfurt
ab. Die Domänenverwaltung Hinterbrühl blieb eine eigene Verwaltunseinheit.
Den Österreichischen Bundesforsten wurden in der Reform
folgende Wirtschaftsziele aufgetragen:
1. Wahrung der ideellen und materiellen Wohlfahrtsaufgaben der Bundesforste
2. Dauernde Deckung der volkswirtschaftlich begründeten Servitutsladten
3. Nachhaltige Lieferung der größtmöglichen Naturalerträge an die österreichische
Volkswirtschaft
4. Lieferung entsprechender Geldreinerträge an den Staatsschatz
Diese Ziele wurden im Gesetzestext erhärtet dargelegt, und
es wurden zudem die Grundsätze einer kaufmännischen Betriebsführung
aufgetragen. Mit der Leitung der Forstverwaltung wurde ein akademischer
Wirtschaftsführer mit dem Berufstitel Forstmeister betraut.
Die territoriale Unterteilung des Wirtschaftsbezirkes Breitenfurt
in 5 Försterbezirke (Laab, Breitenfurt, Wöglerin, Höniggraben, Gruberau)
mit je einem Revierförster wurde bis 1969 beibehalten. Zu diesem Zeitpunkt
erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen der bis dahin als eigene Dienststelle
geführten Bundesforstverwaltung Hinterbrühl mit der Forstverwaltung
Breitenfurt, wobei ca. 1/3 des ehemaligen Forstbezirkes Laab an die
Forstverwaltung Tullnerbach abgegeben wurde. Das Bundesforstgesetz 1925
blieb bis 1978 in Kraft und wurde von da an durch das neue Bunndesforstgesetz
über den Wirtschaftskörper "Österreichische Bundesforste" abgelöst.
Das Bundesforstgesetz
1978
Die Leitung der Österreichischen Bundesforste wird darin
dem Vorstand, der an die Weisung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft
gebunden ist, übertragen. Daneben wurde ein Wirtschadtsrat installiert,
dem es obliegt, die Geschäftsführung zu überwachen.
Die Aufgaben des Betriebes wurden im Gesetz folgendermaßen
festgelegt:
Den Österreichischen Bundesforsten obliegen im Rahmen der
forstrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen vor allem die
Erzielung eines bestmöglichen betriebswirtschaftlichen Erfolges bei
der Produktion und der Verwertung des Rohstoffes Holz und der forstlichen
Nebenprodukte, allenfalls deren Weiterverarbeitung, sowie die bestmögliche
Verwaltung des Betriebsvermögens.
Bei Erfüllung dieser Aufgaben haben die Österreichischen
Bundesforste insbesondere auf folgende weitere Zielsetzung Bedacht zu
nehmen:
a) der Waldboden ist nachhaltig zu bewirtschaften; seine Produktionskraft
zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern;
b) die Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkungen des Waldes sind bestmöglich
zu sichern und weiterzuentwickeln;
c) die Trink- und Nutzwasserreserven sind - wenn daran ein öffentliches
Interesse zu erwarten ist - zu erhalten;
d) Die Interessen der Landwirtschaft, insbesondere der bergbäuerlichen
Betriebe, sowie sonstige öffentliche Interessen sind zu berücksichtigen;
e) Flächen außerhalb des Waldes, die für Erholungszwecke im besonderen
Maße geeignet sind, wie Seeufer, sind vor allem diesen Zwecken zugänglich
zu machen;
f) an der Gestaltung von Naturparks ist mitzuwirken;
g) die Betriebsstruktur ist nach Möglichkeit zu verbessern;
Die Organisation der Forstverwaltung bleibt durch das neue
Gesetz unbeeinträchtigt, und es werden die Agenden des ho. Betriebes
hinsichtlich ihrer zentralen Lenkung und Verwaltung von der Forstverwaltung
in Breitenfurt wahrgenommen, dieser sind weiterhin die vorerwähnten
6 Reviere zugeordnet.
Die neue Forstverwaltung am Königsbühel
|
Das traditionsreiche und über 200 Jahre bestehende Forstverwaltungsgebäude
am Stelzerberg wurde im November 1979 durch das neu errichtete Forstverwaltungsgebäude
am Königsbühl abgelöst.
|


